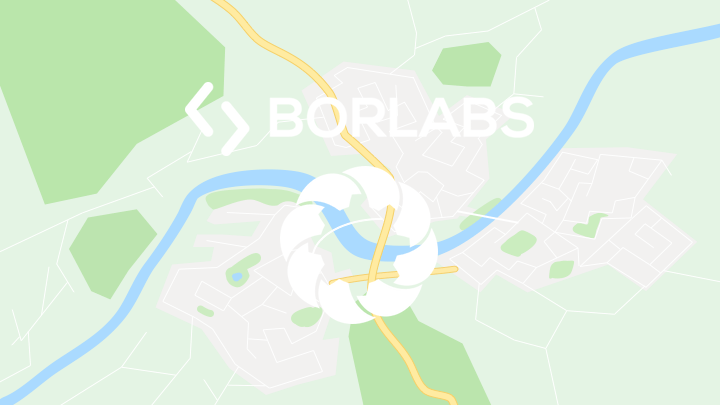Aktuelle Praxis Informationen
Liebe Patientin,
Ich begrüße Sie herzlich zu den Internetseiten meiner Praxis!
Unser Ziel ist es, den Menschen im Vordergrund zu stellen und bei unserer Hilfestellung alle Aspekte der Frauengesundheit zu berücksichtigen. Genauso wie jede Frau einzigartig ist, muss die jewelige Behandlung individuell angepasst sein.
Checkliste für Ihren Praxisbesuch:
- Versicherungs-/Gesundheitskarte
- ggf. Überweisung
- Impfpass

Aktuelle Praxis Informationen
Liebe Patientin,
Ich begrüße Sie herzlich!
Checkliste für Ihren Praxisbesuch:
- Versicherungs-/Gesundheitskarte
- ggf. Überweisung
- Impfpass
Unsere Sprechzeiten
| Wochentag | Vormittags | Nachmittags |
| Montag | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
| Dienstag | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
| Mittwoch | 8:00 – 12:00 | |
| Donnerstag | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
| Freitag | 8:00 – 12:00 | |
Termine nur nach Vereinbarung
Praxis Urlaub 2024/2025
| März | 20.03.24 25.03. – 28.03.24 |
| Mai | 02.05. – 03.05.24 10.05.24 |
| Juni | 28.06.24 |
| Juli/August | 15.07. -09.08.24 |
| September | 30.09.24 |
| Oktober | 04.10.24 14.10. – 18.10.24 |
| Dezember/Januar | 23.12. – 03.01.25 |
Notfallsprechstunde
Montag, Dienstag und Donnerstag, 8 – 10 Uhr und 14 – 16 Uhr. Mittwoch und Freitag, 8 – 10 Uhr.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir organisatorisch nur jeweils 5 Notfälle pro Notfallsprechstunde annehmen können.
Notfallsprechstunde Klinikum Siloah
Roesebeckstr. 15, 30449 Hannover:
Montag, Dienstag und Donnerstag, 19 – 24 Uhr.
Mittwoch, 13 – 24 Uhr, Freitag, 16 – 24 Uhr.
Samstag und Sonntag, 8 – 24 Uhr.
Praxis Arash Ebrahimi in Hannover:
Facharzt für Frauenheilkunde & Geburtshilfe
Osterstraße 24
30159 Hannover
So erreichen Sie die Praxis:
Tel.: Praxis 0511 – 36 38 94
Tel.: Rezept 0511 – 3 02 38 84
Fax: 0511 – 3 02 38 83
Schwerpunkte unserer Praxis für Frauenheilkunde:
Behandlungsspektrum
Wir bieten unseren Patientinnen diverse gynäkologische Leistungen an – sowohl kassenärztliche, als auch Leistungen für Privatpatientinnen oder Selbstzahlerinnen.
Auch wenn Leistungen nicht in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung fallen, können sie medizinisch sinnvoll sein. In einem individuellen Gespräch klären wir, welche Untersuchungen für Sie sinnvoll sind.

Behandlungsspektrum
Wir bieten unseren Patientinnen diverse gynäkologische Leistungen an – sowohl kassenärztliche, als auch Leistungen für Privatpatientinnen oder Selbstzahlerinnen.
Auch wenn Leistungen nicht in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung fallen, können sie medizinisch sinnvoll sein. In einem individuellen Gespräch klären wir, welche Untersuchungen für Sie sinnvoll sind.

Arash Ebrahimi: Teil eines starken Netzwerks